Kulturzeugnisse am „Kultur- und Orchideenweg Wasserliesch“
-
Ferdinand Hein -
Die
Römische Villa von Wasserliesch
Auf dem Wasserliescher Marktplatz stand einmal eine stolze römische Villa. Im 3. Jahrhundert erbaut ist sie damals Kernzelle und Mittelpunkt des Ortes gewesen. An sie erinnert der als modernes Kunstwerk gestaltete Marktbrunnen mit seinen drei markanten Steinsäulen, die den Säulen der römischen Villa nachempfunden sind. Erste Baureste wurden im Jahre 1856 anlässlich der Erweiterung des damaligen Friedhofes entdeckt, der, eingefasst von einer hohen Mauer, einen großen Teil des heutigen Marktplatzes in Anspruch nahm. Während der Bauarbeiten kamen umfangreiche Mauerreste und viele Ausstattungsgegenstände ans Tageslicht, sodass eine Rekonstruktion des Grundrisses der Anlage für diesem Bereich möglich war. Umfassende archäologische Ausgrabungen seien „wegen sonstiger Entweihung der Gräber“ jedoch nicht möglich gewesen, so der Jahresbericht der Trierer „Gesellschaft für nützliche Forschungen“ aus dem Jahre 1857. Weiter heißt es darin, die Mauerreste, marmorne Bodenbeläge und Wandplatten der Villa seien von den mit der Friedhofserweiterung beauftragten Arbeitern als Baumaterial für ihr Haus und zur Befestigung der vorbeiführenden Straße verwendet worden. Die außerhalb der Friedhofserweiterung liegenden Mauerreste des nach Süden, also zum Liescher Berg hin, ausgerichteten Teils der Villa mit seiner halbkreisförmig hervortretenden Gebäudefront befinden sich im Bereich der Bahntrasse. Beim Bau der Eisenbahn – die Strecke wurde 1878 in Betrieb genommen – sind vermutlich noch einmal Teile der Villa zerstört worden. Ebenso soll dem genannten Bericht zufolge Mauerwerk für die vorher auf dem alten Friedhof stehende Pfarrkirche verwendet worden sein. Sie wurde schon im 10. Jahrhundert erbaut und stand bis 1920 an dieser Stelle.

 Wenn Sie vom
Marktplatz aus den in der Übersichtskarte blau gekennzeichneten Teil des Kultur-
und Orchideenweges Wasserliesch begehen, treffen Sie in der Kapellenstraße
auf den Stationenweg. Der Weg wurde vor rund 200 Jahren – Anfang des
19. Jahrhunderts – von hier aus bis zur Wallfahrtskapelle auf der Höhe des Liescher
Berges angelegt. Er überwindet auf eine Länge von etwa 1,5 km rund 200 Höhenmeter.
Insgesamt 14 Kreuzwegstationen stehen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen
von je bis zu ca. 100 m am Wegrand. Die Bildstöcke stellen den „Kreuzweg“
Jesu Christi dar, den er vor seiner Kreuzigung, das eigene Kreuz tragend, gehen
musste, und stellen folgende Situationen dar:
Wenn Sie vom
Marktplatz aus den in der Übersichtskarte blau gekennzeichneten Teil des Kultur-
und Orchideenweges Wasserliesch begehen, treffen Sie in der Kapellenstraße
auf den Stationenweg. Der Weg wurde vor rund 200 Jahren – Anfang des
19. Jahrhunderts – von hier aus bis zur Wallfahrtskapelle auf der Höhe des Liescher
Berges angelegt. Er überwindet auf eine Länge von etwa 1,5 km rund 200 Höhenmeter.
Insgesamt 14 Kreuzwegstationen stehen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen
von je bis zu ca. 100 m am Wegrand. Die Bildstöcke stellen den „Kreuzweg“
Jesu Christi dar, den er vor seiner Kreuzigung, das eigene Kreuz tragend, gehen
musste, und stellen folgende Situationen dar:- Jesus wird zum Tode
verurteilt.
- Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern.
- Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz.
- Jesus begegnet seiner tief betrübten Mutter.
- Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen.
- Veronika reicht Jesus das Schweißtuch.
- Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz.
- Jesus tröstet die weinenden Frauen.
- Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz.
- Jesus wird seiner Kleider beraubt.
- Jesus wird ans Kreuz geschlagen.
- Jesus stirbt am Kreuz.
- Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt.
- Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt.
Einige Bildstöcke tragen
Jahreszahlen, die 2. Station die römische Jahreszahl MDCCCXX (1820), die 9.
Station die Jahreszahl 1812. Leider zeigen inzwischen mehrere deutliche
Verwitterungsspuren. Ein Teil ist Ende der 1980er Jahre restauriert oder
erneuert worden, deshalb trägt der Sockel der ersten Station die Jahreszahl
1988.
Das Herrichten des Stationenweges soll, einschließlich des Aufstellens der Stationen, 12 Jahre in Anspruch genommen haben. Die einheitlich gestalteten Bildstöcke sind Bildhauerarbeiten, teils aus gelbem, teils aus rotem, heimischem, Sandstein gehauen. In das Oberteil sind gusseiserne Reliefs eingelassen, welche die beschriebene Situation bildhaft darstellen. Die Bildstöcke bezeugen das handwerkliche und künstlerische Können der Wasserliescher Steinbrecher und Steinmetze. Wartung und Pflege der einzelnen Stationen übernahmen nach dem Bau einheimische Bürger und führten sie traditionell von Generation zu Generation in der Familie fort; bei einigen Stationen ist das noch heute der Fall.
Um
die Entstehung des Stationenweges rankt sich eine Legende, die ein
Wasserliescher Lehrer im Jahre 1938 in seinem Manuskript für eine Dorfchronik
so erzählt:
„Ein Mädchen des Dorfes arbeitete als Näherin in Luxemburg. Eines
Abends musste es noch bis spät in die Nacht nähen. Als es allein im Zimmer
war, klopfte es gegen Mitternacht an die Tür, und herein trat ein alter
Wasserliescher Mann. Erstaunt über den späten Besuch, fragte das Mädchen, was
er wolle und woher er käme, worauf dieser antwortete: „Gehe nach Wasserliesch
zu meinen Angehörigen und sage ihnen, ich hätte mir vorgenommen, einen
Kreuzweg nach Löschem zu bauen. Doch, da es mir nicht mehr möglich ist, mein
Vorhaben auszuführen, mögen sie sofort mit dem Bau beginnen. Verwundert
fragte das Mädchen, warum er es ihnen nicht selbst sage. Doch keine Antwort
erfolgte. Als es aufschaute, war der Mann verschwunden. Am anderen Morgen
machte sich das Mädchen auf den Heimweg. Zu Hause erzählte es sein Erlebnis
und erfuhr zu seinem größten Entsetzen, dass der Mann bereits 14 Tage begraben
sei. Nun säumten die Angehörigen nicht lange und erfüllten den Wunsch des
Verstorbenen.“
Die
Wallfahrtskapelle auf dem Liescher Berg
 Am Ende des Stationenweges erreichen Sie auf der Höhe
des Liescher Berges an exponierter Stelle die Löschemer Kapelle.
Gleich vor diesem Kulturdenkmal, das als Marienwallfahrtsort viel besucht wird, fällt
der Liescher Berg über eine Felswand steil ab. Hier bietet sich Ihnen
ein großartiger Panoramablick hinunter ins Mosel- und Saartal, auf den am anderen
Ufer der Mosel gelegenen Ort Igel, über die Saarmündung und die Stadt Konz hinweg
bis nach Trier und darüber hinaus. Mosel- und Saartal werden hier von den
vielfach bewaldeten Höhen dreier Mittelgebirgszüge flankiert. Im Westen
blickt man auf den zu Luxemburg gehörenden südlichen Ausläufer der Ardennen,
im Norden auf die Eifel und im Osten auf die Erhebungen des zum Hunsrück
gehörenden Schwarzwälder Hochwaldes.
Am Ende des Stationenweges erreichen Sie auf der Höhe
des Liescher Berges an exponierter Stelle die Löschemer Kapelle.
Gleich vor diesem Kulturdenkmal, das als Marienwallfahrtsort viel besucht wird, fällt
der Liescher Berg über eine Felswand steil ab. Hier bietet sich Ihnen
ein großartiger Panoramablick hinunter ins Mosel- und Saartal, auf den am anderen
Ufer der Mosel gelegenen Ort Igel, über die Saarmündung und die Stadt Konz hinweg
bis nach Trier und darüber hinaus. Mosel- und Saartal werden hier von den
vielfach bewaldeten Höhen dreier Mittelgebirgszüge flankiert. Im Westen
blickt man auf den zu Luxemburg gehörenden südlichen Ausläufer der Ardennen,
im Norden auf die Eifel und im Osten auf die Erhebungen des zum Hunsrück
gehörenden Schwarzwälder Hochwaldes.
Ein Text aus dem 19. Jahrhundert beschreibt die Löschemer Kapelle als einen
„Bau von einer Achse, innen 3,0 x 5,80 m groß, mit geradem Chorschluss und flacher Decke, die in den Ecken abgerundet ist, die Front einfach gegliedert, mit Figurennische über dem Rundbogenportal und rundgeschlossenen Fenstern, auf der Mensa eine Steinnische mit Giebelabschluss für ein einfaches Kruzifix; auf seitlichen Konsolen Figuren der Mutter Gottes und des hl. Franziskus.“
Auf der Mensa, dem Altartisch, steht eine Pietà, eine großfigürliche Darstellung Maria’s mit dem Leichnam Jesu Christi auf dem Schoß, wie sie vor allem in katholischen Gotteshäusern „zum Gedächtnis der Schmerzen Mariens“ häufig anzutreffen ist; die Skulptur ist erst im 20. Jahrhundert, vermutlich nach dem Ersten Weltkrieg, hier aufgestellt worden. Die Darstellung einer Pietà findet sich auch als dreizehnte Station des insgesamt aus 14 Stationen bestehenden Kreuzweges Jesu Christi. Sie ist am Kultur- und Orchideenweg als vorletzte Station des „Stationenweges“, etwa 100 m unterhalb der Löschemer Kapelle, zu sehen.
Wie alt ist dieses ehrwürdige Kulturdenkmal?
In
seinem Manuskript für eine Chronik von Wasserliesch schreibt im Jahre 1938 ein
damaliger Lehrer dazu unter anderem: „Die Kapelle soll ihren Ursprung einem
Einsiedler verdanken und zu Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut worden sein. Da
sie im Laufe der Zeit verfiel, war der schöne Punkt (gemeint ist der
exponierte Standort der Kapelle) bald öde geworden. Vor etwa 95 Jahren, nach
1840, wurde sie aus Schutt und Asche aufgebaut und erfreut sich seither wieder
des Rufes eines Wallfahrtsortes“.
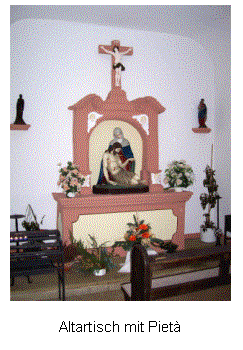 Heute weiß man Genaueres über das Alter
der Löschemer Kapelle und ihren Wiederaufbau Mitte des 19. Jahrhunderts.
So gibt das Gesuch der Beigeordneten der Gemeinde Wasserliesch vom 27. April
1846 an „Eine Königliche, Hochlöbliche Regierung zu Trier“ einige
Informationen. Darin bitten die Unterzeichner um Übernahme der Kosten in Höhe
von 80 Talern für Kunstarbeiten bei der beabsichtigten Wiedererrichtung der
Kapelle. Im Text heißt es, die Gemeinde besitze „seit etwa 60 – 70
Jahren auf der Höhe des Berges hinter dem Dorfe eine Kapelle von frommer Stiftung
herrührend, worin nicht nur die Einwohner von Wasserliesch, sondern
auch jene der Umgebung wallfahrend ihr Gebet verrichteten“. Sie sei seit
etwa zwei Jahren ganz verfallen und die Gemeinde habe den Wunsch, „diesen verehrten
Wallfahrtsort wiederherzustellen“. Das Schreiben endet mit der heute als
merkwürdig empfundenen Höflichkeitsformel: „Eine günstige Entscheidung
erflehend haben die Ehre zu sein Eure Königliche, Hochlöbliche Regierung
gehorsamsten Diener“. Unterzeichnet ist es von den 24 Beigeordneten der
Gemeinden Wasserliesch und Reinig sowie eines Mitunterzeichners aus der Nachbargemeinde
Oberbillig.
Heute weiß man Genaueres über das Alter
der Löschemer Kapelle und ihren Wiederaufbau Mitte des 19. Jahrhunderts.
So gibt das Gesuch der Beigeordneten der Gemeinde Wasserliesch vom 27. April
1846 an „Eine Königliche, Hochlöbliche Regierung zu Trier“ einige
Informationen. Darin bitten die Unterzeichner um Übernahme der Kosten in Höhe
von 80 Talern für Kunstarbeiten bei der beabsichtigten Wiedererrichtung der
Kapelle. Im Text heißt es, die Gemeinde besitze „seit etwa 60 – 70
Jahren auf der Höhe des Berges hinter dem Dorfe eine Kapelle von frommer Stiftung
herrührend, worin nicht nur die Einwohner von Wasserliesch, sondern
auch jene der Umgebung wallfahrend ihr Gebet verrichteten“. Sie sei seit
etwa zwei Jahren ganz verfallen und die Gemeinde habe den Wunsch, „diesen verehrten
Wallfahrtsort wiederherzustellen“. Das Schreiben endet mit der heute als
merkwürdig empfundenen Höflichkeitsformel: „Eine günstige Entscheidung
erflehend haben die Ehre zu sein Eure Königliche, Hochlöbliche Regierung
gehorsamsten Diener“. Unterzeichnet ist es von den 24 Beigeordneten der
Gemeinden Wasserliesch und Reinig sowie eines Mitunterzeichners aus der Nachbargemeinde
Oberbillig.
Die Behörde lehnte die Übernahme der Kosten umgehend ab, obwohl die Antragsteller doch „ehrfurchtsvoll“ darum gebeten und betont hatten, die Einwohner von Wasserliesch seien bereit, „alle Hand und Spanndienste unentgeltlich zu leisten, was gewiss kein unbedeutendes Opfer“ sei, „wenn man berücksichtigt, dass die Kapelle auf dem höchsten Bergpunkt der Umgebung liegt“ – so der authentische Text. Man hatte sich sogar erlaubt, nachdrücklich „dahin aufmerksam zu machen, dass die Einwohner von Wasserliesch bisher bei allen Anforderungen seitens der Verwaltung stets eine anzuerkennende Folgsamkeit bewiesen“ hätten und angedeutet, dass die Bereitschaft, „Dienste in der Frohnde“ zu leisten, „Schaden leiden dürfte, wenn der Gemeinde das Gesuch zur Beihilfe bei dem Bau der fraglichen Kapelle abgelehnt bleiben würde“. Es war zweifellos ein Versuch, Druck auf die Behörde auszuüben, doch auch das nützte nichts.
Als Begründung für ihre Ablehnung gab die Behörde an, „der dortige Kirchenbau“ sei „viel nötiger als die Kapelle“. Gemeint war die Erweiterung der auf dem heute nicht mehr existierenden alten Friedhof stehenden Pfarrkirche, die man fünf Jahre später realisierte. Doch trotz der Verweigerung des Kostenzuschusses bauten die Wasserliescher und Reiniger Bürger die Löschemer Kapelle im Jahre 1846 mit eigenen Mitteln und Spenden der Bevölkerung der Nachbarorte wieder auf. Wie der Chronist zu berichten weiß, standen vor dem Wiederaufbau nur noch die Außenmauern, die man beim Wiederaufbau mit verwendete.
Dem
Bittschreiben der Gemeindeväter kann man entnehmen, dass die Löschemer
Kapelle „von frommer Stiftung herrührend“ in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts in den Besitz der Gemeinde gelangte. Vorher könnte sie dem
Kloster St. Alban in Merzlich-Karthaus, heute Stadtteil von Konz, gehört haben,
das Besitzungen in Wasserliesch und Reinig hatte. Im Jahre 1919 wird die
Kapelle erstmals in einem Inventarverzeichnis der Pfarrgemeinde erwähnt, ist
also hiernach nach dem Ersten Weltkrieg in Kirchenbesitz übergegangen.
Mittlerweile
ist sicher, dass die Löschemer Kapelle Anfang des 18. Jahrhunderts
erbaut worden ist. Die „Chronik Wasserliesch“ nennt das Jahr 1708 noch als angebliches
Baujahr. Einen genauen Hinweis auf den Zeitpunkt ihrer Erbauung liefert der
Jahresbericht der „Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier“ aus dem
Jahre 1853. Dieser Bericht enthält einen Artikel mit der Überschrift „Das
Lager auf dem Liescher Berge“, in dem die Löschemer Kapelle
ausdrücklich erwähnt wird. Das verwundert, weil es zwischen ihr und dem
Bericht über das Alte Römerlager keinen sachlichen Zusammenhang gibt. Der
Bericht beginnt mit dem Satz:
„Der Wasserliescher Berg, von dem die Bernarduskapelle
in das Trierische Thal herabschauet, erhebt sich als Endpunkt des Gebirges zwischen
Mosel und Saar zu einer Höhe von mehr als 500 Fuß, mit ringsum sehr steilen
Wänden“ und endet mit der Feststellung, die man hier
nicht mehr erwartet: „Die Bernarduskapelle trägt das Chronostichon ConseCratVM
honorI beatI BernarDI abbatIs (1709)“.
Das
„Chronostichon“, auch „Chronodistichon“ genannt, ist ein Chronogramm in lateinischer
Sprache und lautet, in Normalschrift: „Consecratum honori beati Bernardi
abbatis“, auf Deutsch: „Geweiht zur Ehre des seligen Abtes Bernhard“. Es
dokumentiert damit nicht nur, dass die Löschemer Kapelle nach ihrer
Errichtung dem heiligen Bernhard geweiht wurde, sondern nennt gleichzeitig ihr
Alter in römischen Zahlen, die im Text versteckt sind. Die im Original
hervorgehobenen – groß geschriebenen – Buchstaben mit ihren Zahlwerten (C =
100, V = 5, M = 1000, I = 1 und D = 500) ergeben zusammenaddiert das Jahr
1709. Die Löschemer Kapelle ist also, diesem Chronogramm zufolge, im
Jahre 1709 geweiht worden, womit das Baujahr 1708 indirekt bestätigt wird. Mit
„Bernhard“ ist Bernhard von Clairveaux gemeint, Zisterzienserabt und
Kirchenlehrer, der ~1090 geboren wurde und bis zum 20.8.1153 lebte. Leider ist das
Chronodistichon, das diese Aussage belegt, in der Kapelle heute nicht mehr
vorhanden. Vermutlich wurde es bei Renovierungsarbeiten beseitigt oder
überdeckt und ist dann in Vergessenheit geraten.
Die Tatsache, dass die Löschemer Kapelle als
„Bernharduskapelle“ ursprünglich dem heiligen Bernhard geweiht war, ist heute
nicht mehr allgemein bekannt. Vermutlich hat man es vergessen oder verdrängt,
weil hier seit langem die „Schmerzhafte Mutter Gottes“ verehrt wird. Jedenfalls
ist sie heute eine „Marienkapelle“.
Wann die Marienverehrung begann, weiß niemand, sicher war das nicht von Anfang
an der Fall. Vermutlich entwickelte sie sich erst nach dem Wiederaufbau im
Jahre 1846. Den Anstoß könnte das von Papst Pius IX. im Jahre 1854
verkündete Dogma der „Unbefleckten Empfängnis“ Mariens gegeben haben, das der
Marienverehrung damals weltweit großen Auftrieb gab.
Nach dem Manuskript einer Ortschronik des damaligen Wasserliescher
Lehrers Neises aus dem Jahre 1938 ist das Innere der Löschemer Kapelle Ende
des 19. Jahrhunderts durch eine Lourdes-Grotte „verschönert“ worden. Die Grotte
sei am 20. August 1893 in feierlicher Prozession den Berg hinauf geschafft worden.
Heute ist sie nicht mehr vorhanden; wann sie wieder entfernt wurde, ist
unbekannt. Jedenfalls wird die Mutter Gottes in der Löschemer Kapelle
seit Menschengedenken verehrt. Danktafeln an den Innenwänden und brennende
Votivkerzen vor dem Altarbild belegen, dass nach wie vor viele Gläubige hier
Hilfe und Trost suchen und finden.
Seit ihrem Wiederaufbau im Jahre 1846 erforderte die Löschemer Kapelle rund 100 Jahre lang, außer einem immer wieder mal fälligen Innenanstrich, keine nennenswerten Unterhaltungsaufwendungen, obwohl unter anderem zwei Weltkriege über sie hinweggegangen sind. Erst 1969/70 war wieder eine durchgreifende Renovierung mit vollständiger Dacherneuerung notwendig. Im Jahre 2003 wurde der Außenbereich mit einem festen Bodenbelag, neuen Treppenstufen, schmiedeeisernen Handläufen und einem ebensolchen Geländer als Abschluss zur Talseite hin neu gestaltet und der Innenraum renoviert.
Bis lange in die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hinein – und manchmal auch heute noch – bewältigen wallfahrende Besucher die 200 Höhenmeter von der Talsohle bis zur Löschemer Kapelle, den Rosenkranz betend und Marienlieder singend, meist in kleinen Gruppen zu Fuß, im wesentlichen auf einem der folgenden drei Wege:
Vom
Ortsteil Reinig aus bevorzugte man früher den in der Mundart „Löschemer
Piёdchen“ (Pfädchen) genannten Weg. Er zweigte von der Granastraße in
Richtung Wald ab, folgte in etwa der Straße „Im Kestenbüsch“, dann dem unteren
Weg im Wald, im so genannten „Kopf“. Ab der nach ca. 200 m anzutreffenden Weggabelung
bot er den Pilgern zwei Varianten. Die eine, beschwerlichere, aber etwas
kürzere, führte an dem auf gleicher Höhe liegenden Buntsandsteinfelsen vorbei,
dann als schmaler und steiniger Steig den Berg hinauf, bis er auf halber
Berghöhe, ungefähr an der 10. Kreuzwegstation des Stationenweges, in diesen
einmündete – diese Variante ist heute nicht mehr begehbar. Die andere Variante
mündete von der genannten Weggabelung aus dem Weg nach oben folgend in den
Kultur- und Orchideenweg, dann weiter an dem Kriegerehrenmal und dem alten
Steinbruch im Wald (siehe dort) vorbei, um wenige Meter oberhalb der
erstgenannten Teilstrecke den Stationenweg zu erreichen. Diesen vom Ortsteil
Reinig aus zur Löschemer Kapelle führenden Weg konnte und kann man, bei
guter körperlicher Verfassung, in ca. einer Stunde bewältigen.
Kürzer, aber steiler und daher beschwerlicher zu begehen, führt der „Stationenweg“ unmittelbar vom Ortszentrum aus direkt zur Löschemer Kapelle hinauf. Hier bieten sich die 14 Kreuzwegstationen als Ruhepunkte und Gebetsstätten an. Wer gut zu Fuß ist und sich in guter körperlicher Verfassung befindet, kann diesen Weg in knapp einer Stunde schaffen. Der Stationenweg sollte allerdings, wie auch der Kultur- und Orchideenweg und die übrigen Wege am Berghang des Löschemer Berges, nur mit geeignetem Schuhwerk begangen werden.
Der „bequemste“ aber längste Weg zur Löschemer Kapelle führt aus dem Ort heraus über die Löschemer Straße den Berg hinauf bis zum Parkplatz „Perfeist“ und von dort aus fast eben, sozusagen den Kultur- und Orchideenweg rückwärts entlang. Früher, noch als Schotterweg ausgebaut, zog man diese Möglichkeit den anderen beiden Wegstrecken nicht unbedingt vor, erforderte er doch deutlich mehr als eine Stunde Fußmarsch. Allerdings bot er damals wie heute die einzige Möglichkeit, die Löschemer Kapelle mit Fahrzeugen zu erreichen. Früher nutzte man diese Wegstrecke im Frühjahr regelmäßig für die letzte der traditionell an drei aufeinander folgenden Tagen stattfindenden „Bittprozessionen“. Voran die Ministranten in ihren rotweißen Röcken, das Kreuz abwechselnd tragend, gefolgt vom Pastor im vollen Ornat, dahinter eine lange Reihe wallfahrender Teilnehmer, startete die Prozession frühmorgens um 6 Uhr an der Pfarrkirche und bewegte sich betend und singend den Berg hinauf bis zur Löschemer Kapelle, in der eine Marienandacht den Abschluss bildete.
Wer
einen dieser drei Wege zur Löschemer Kapelle schon einmal begangen hat,
kann leicht nachvollziehen, weshalb die Antragsteller in dem oben zitierten
Bittschreiben zur Erlangung eines Kostenzuschusses darauf hingewiesen haben,
dass die Kapelle auf „dem höchsten Bergpunkt der Umgebung“ stehe. Zwar
ist der Liescher Berg keineswegs die höchste Erhebung hier, doch war es
in der Tat recht beschwerlich, das notwendige Baumaterial und Handwerkszeug zur
Kapelle zu schaffen. Als Frondienst leistender oder Freiwilliger musste man ja
viele Male zu Fuß mit all diesen Dingen beladen den Berg hinauf- und wieder
heruntersteigen. Ähnlich beschwerlich war es natürlich für die wallfahrenden
Gläubigen, wenn sie denn einen der drei Wege von unten bis oben und wieder
zurück zu Fuß zurücklegten. Eine „Wallfahrt nach Löschem“, wie man allgemein
sagte, geriet da leicht zu einem echten Bußgang. Heutzutage macht man es sich
in der Regel leichter, denn vom Parkplatz „Perfeist“ aus kann der „moderne
Pilger“ die Löschemer Kapelle in einem bequemen Spaziergang nach 10 bis
15 Minuten Fußweg erreichen.
Granahöhe
und
Granadenkmal, ein Ort der Geschichte
Wenn Sie sich
Wasserliesch von Trier oder Konz herkommend nähern, fällt Ihnen die imposante
steil abfallende Flanke des 347 Meter hohen Liescher Berges, hier auch
„Löschemer Berg“ genannt, sofort ins Auge. Dagegen wirkt die rundum bewaldete
etwa 30 Meter hohe Granahöhe als eine der unteren Terrassenstufen des
Berghanges mit dem Granadenkmal darauf eher unscheinbar. Man sieht es
ihr nicht an, dass sie und das weite Tal am Zusammenfluss von Saar und Mosel
mit den angrenzenden Berghängen im
Jahr 1675 Schauplatz eines bedeutenden kriegerischen Ereignisses war,
das als „Die Schlacht bei der Conzer Brück“ in die Geschichte
eingegangen ist.
Dem in der Übersichtskarte rot
gekennzeichneten Kultur- und Orchideenweg Wasserliesch vom
Ausgangpunkt am Tennisplatz in Richtung Granahöhe folgend oder auf einem
der unterhalb der Granahöhe beginnenden Fußpfade aufwärts wandernd,
erreichen Sie auf der Höhe des Felsgrades oberhalb roter Buntsandsteinfelsen
das monumental wirkende Granadenkmal. Aus Sandstein gehauen, eingefasst von
einer niedrigen Mauer mit gusseisernem Geländer, steht das Kulturdenkmal
auf einem wuchtigen Stufenpodest. Vielleicht überrascht es, auf einer Seite
des Obelisken in den Stein gemeißelt „Errichtet 1892“ zu lesen, denn
damals, während der Regierungszeit Kaiser Wilhelm II., waren ja seit
der Schlacht schon mehr als 200 Jahre ins Land gegangen.
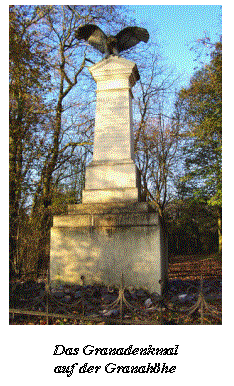 Nun
erinnert das Granadenkmal nicht in erster Linie, wie man denken könnte, an den
Generalmajor de Grana, dessen Namen es trägt. Auch wenn er es
war, der damals einen Teil der Truppen des Deutschen Kaisers Leopold I. aus
dem Hause Habsburg im Kampf gegen eine Armee des Sonnenkönigs Ludwig XIV.
erfolgreich führte, ging es den Erbauern des Denkmals wohl mehr um den
„glänzenden Sieg“ – so die Inschrift, den die kaiserlichen Truppen im Kampf
mit den jahrhundertelang als Erzfeinde geltenden Franzosen erringen konnten.
Folglich gibt es auf oder an dem Monument auch keine Figur oder Abbildung des
Generals. Vielmehr erhebt sich darauf ein steinerner Reichsadler.
Offensichtlich hatten sich die Erbauer rund 20 Jahre nach der Gründung des
zweiten Deutschen Reiches im Jahre 1871 mehr vom Nationalbewusstsein als von
dem schon sehr lange zurückliegenden Kriegsgeschehen inspirieren lassen.
Nun
erinnert das Granadenkmal nicht in erster Linie, wie man denken könnte, an den
Generalmajor de Grana, dessen Namen es trägt. Auch wenn er es
war, der damals einen Teil der Truppen des Deutschen Kaisers Leopold I. aus
dem Hause Habsburg im Kampf gegen eine Armee des Sonnenkönigs Ludwig XIV.
erfolgreich führte, ging es den Erbauern des Denkmals wohl mehr um den
„glänzenden Sieg“ – so die Inschrift, den die kaiserlichen Truppen im Kampf
mit den jahrhundertelang als Erzfeinde geltenden Franzosen erringen konnten.
Folglich gibt es auf oder an dem Monument auch keine Figur oder Abbildung des
Generals. Vielmehr erhebt sich darauf ein steinerner Reichsadler.
Offensichtlich hatten sich die Erbauer rund 20 Jahre nach der Gründung des
zweiten Deutschen Reiches im Jahre 1871 mehr vom Nationalbewusstsein als von
dem schon sehr lange zurückliegenden Kriegsgeschehen inspirieren lassen.
Die Enthüllung des neu errichteten
Granadenkmals am Nachmittag des 7. August 1892 war ein Großereignis, über das
die damalige „Trierische Landeszeitung“ ausführlich berichtete. Der
Zeitungsartikel schilderte das Geschehen unter anderem wie folgt:
„Conz-Karthaus 7. August. Von herrlicher
Witterung mittlerer Temperatur begünstigt, fand heute Nachmittag die feierliche
Enthüllung des auf dem Schlachtfelde bei Conz errichteten Grana-Denkmals statt.
Wie vorauszusehen, war die Beteiligung ungemein groß, und so gestaltete sich
die schöne Feier zu einer erhebend-patriotischen Kundgebung“.
„Deputationen“ begrüßten die anreisenden Ehrengäste und
andere Teilnehmer auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Konz. Aus Trier traf sogar ein
eigens eingesetzter Sonderzug ein. Kurz nach 15 Uhr setzte sich ein langer
Festzug unter den Klängen der Kapelle des 69. Infanterie-Regiments, „welche
zur Hebung der Feier zur Verfügung gestellt war, unter den herrlich
schmetternden und wirbelnden Klängen der Musik durch die in prächtigen Fahnen-
und Girlandenschmuck prangenden Straßen durch Conz über die Saarbrücke zur
Granahöhe“ in Bewegung. Neben hunderten von Teilnehmern beteiligten sich
eine Vielzahl einheimischer und auswärtiger Vereine an der Feier, wie
Kriegerverein, Kriegerbund, Turnverein, Casino-Gesellschaft sowie Gesang- und
Musikvereine. Auch die Fähnchen schwingende Schuljugend unter der Führung von
Lehrer und Pfarrer fehlte nicht, „was sehr schön aussah“, wie die
Zeitung schreibt – allerdings durften nur die Jungen Fähnchen schwingen.
Der Bericht betont ausdrücklich die
patriotische Stimmung und stellt fest: „Insbesondere lenkte der Triumphbogen
des „Kriegerbund“ durch seine sinnreiche Ausführung die Aufmerksamkeit der
Vorübergehenden auf sich. Die Inschriften: „Dolce et decorum est pro patria
mori“ (Süß und ehrenvoll ist es, für’s Vaterland zu sterben) und weiter: „Laßt,
bevor wir unsre Schritte bergan lenken, uns noch der im Thal Gefall’nen hier
gedenken!“ zerstreuen jeden Zweifel daran, dass sich die Erbauer des
Granadenkmals vom neu gewonnenen Nationalbewusstsein leiten ließen. So sprach
denn auch der Festredner, der Trierer Regierungspräsident von Heppe, vor der
Übergabe des Denkmals an den damaligen Gemeindeverband Konz–Wasserliesch „von
den früheren bemuthigenden („entmutigenden“ würde man heute sagen) Zuständen
im deutschen Lande“ und verwies auf „unser heutiges einiges und
mächtiges Deutschland“. Er erinnerte an „die Bedeutung der Schlacht bei
Conz am 11. August 1675, deren Andenken gefeiert werde durch das errichtete
Grana-Denkmal“.
Und weiter schreibt die Zeitung: „Das am
Schlusse der Festrede beim Fallen der Hülle mit zündenden Worten ausgebrachte
Hoch auf Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. fand brausenden
Widerhall. Darauf wurde von der unübersehbaren Menschenmenge unter den Klängen
der Musik die Nationalhymne (damals noch die Kaiserhymne: „Heil, dir im
Siegerkranz“) gesungen. Im weiteren Verlauf der Feier wechselten Musikstücke
und gemeinsame Vorträge patriotischer Lieder“. Heute, rund 120 Jahre
danach, kann man all das nur noch schwer nachvollziehen.
Der Rest der Einweihungsfeier trug
Volksfestcharakter. Es gab, wie auch heute noch bei ähnlichen Anlässen, belegte
Brötchen, heiße Würstchen und Getränke. Die Besucher bemühten sich, wie es
heißt, in einem unterhalb der Granahöhe aufgestellten Zelt eines Konzer
Gastwirts „den leiblichen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Doch vielen
Hunderten konnte dieß bei der großen Menschenmenge nicht gelingen. Viele zogen
daher nach den benachbarten Orten.“ Schließlich brannte man bei Eintritt
der Dunkelheit auf der Granahöhe ein großes Feuerwerk ab, und „den Schluss
des schönen Nationalfestes für Conz-Karthaus und Umgebung bildete ein von den
hiesigen Vereinen veranstalteter Ball.“
Der vollständige auf den vier Seiten des Grana-Denkmals in den Obelisken eingemeißelte Text der Inschrift lautet:
ZUR ERINNERUNG AN DIE SCHLACHT BEI
DER CONZER BRÜCKE
·
Am 11. August 1675 erfochten hier Deutsche
Truppen, Kaiserliche, Lothringer, Lüneburger, Münsterländer, Osnabrücker,
Trierer unter Herzog Georg Wilh. v. Braunschweig-Lüneburg über die Franzosen
unter Marschall de Crequi einen glänzenden Sieg. Bleibt Deutsche einträchtig!
So bleibt ihr ... mächtig.
·
Bald nach dieser Schlacht wurde
Trier der Gewalt der Franzosen entrissen und der durch deutsche Gesinnung
ausgezeichnete Kurfürst Erzbischof Karl Kaspar von der Leyen zog wieder in
seine Hauptstadt ein.
·
Von dieser Höhe setzte der
Kaiserliche General GRANA den Angriff des rechten Flügels an, der die
Niederlage der Feinde nach dreistündigem Kampfe entschied.
·
ERRICHTET
1892
Interessant ist, dass der zweite Teil des
zitierten Satzes: „Bleibt Deutsche einträchtig, so bleibt ihr mächtig,“ ursprünglich
einmal lautete: „... so bleibt ihr stets mächtig“. Das Wörtchen „stets“
wurde irgendwann entfernt, die Lücke im Text ist deutlich erkennbar. Leider ist
nicht bekannt, aus welchem Grund das geschah und wer es veranlasste.
Nach der Einweihung entwickelten sich
Granahöhe und Granadenkmal zu einem beliebten Ausflugsziel für Wanderer und
Spaziergänger und blieben es bis in die Jahre des Zweiten Weltkrieges hinein;
danach geriet die Gedenkstätte mehr und mehr in Vergessenheit. Dennoch schrieb
sie auch weiterhin Geschichte. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, besetzten
zunächst die Amerikaner unsere Gegend, die Franzosen lösten sie kurz danach ab.
Sie errichteten in der Niederung um die Granahöhe herum auf einem Teil des
historischen Schlachtfeldes ein großes Militärlager, das rund vierzig Jahre
bestehen bleiben sollte. Sinnigerweise trug es den Namen „Lager Granahöhe“,
eine Bezeichnung, die die Franzosen eigentlich ständig an die fast dreihundert
Jahre vorher auf dem Gelände erlittene Niederlage hätte erinnern müssen.
Vermutlich war das den Verantwortlichen, zumindest anfangs, nicht bewusst,
sonst hätten sie wohl einen anderen Namen gewählt und möglicherweise sogar das
Granadenkmal zerstört. Es blieb jedoch unversehrt und führte zwischen immer
höher aufwachsenden Bäumen lange Zeit einen Dornröschenschlaf. Erst in den
1990er Jahren erinnerte man sich seiner, renovierte es und sorgte wieder für
freie Sicht in die Ebene hinein.
Wer war denn dieser Generalmajor
Otto Heinrich Marchese de Savone Caretto de Grana, wie er mit
vollem Namen hieß?
Die Frage ist nicht einfach zu beantworten,
denn in der einschlägigen Literatur sucht man ihn oft vergeblich. Bekannt ist,
dass er im Jahre 1639 in Genua geboren wurde und am 15. Juni 1685 in Mariemont
in der belgischen Provinz Hennegau starb. Er ist also nur 46 Jahre alt
geworden, was zur damaligen Zeit nicht ungewöhnlich war. Zu Zeiten Kaiser
Leopold I., der von 1658 bis 1705 regierte, ist er Kommandant der
kaiserlichen Truppen in Bonn gewesen. Weitere Einzelheiten seines Wirkens sind
nicht bekannt. Jedenfalls richtete er am 11. August 1675 nachts oder
frühmorgens vor der Schlacht an der Konzer Brücke sein Hauptquartier auf der
niedrigen Anhöhe ein, die heute seinen Namen trägt. De Grana ist also nicht als
großer Heerführer in die Geschichte eingegangen, auch wenn ihm der Sieg über
die Franzosen in der Schlacht an der für den Übergang über die Saar wichtigen
Konzer Brücke einen gewissen Ruhm verschaffte. Mehr aber auch nicht, was wohl
damit zusammenhängt, dass die gewonnene Schlacht zwar die Stadt Trier und das
Trierer Land von der französischen Besatzung befreite, aber die politische
Landschaft in Deutschland insgesamt nur wenig beeinflusste.
Doch wie kam es eigentlich zu der für die
kaiserlichen Truppen siegreichen Schlacht im Gelände um die Granahöhe herum?
Der Westfälische Friede hielt nicht lange
 In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wirkten in
unserer Heimat die Folgen des mit dem „Westfälischen Frieden“ im Jahre 1648 zu
Ende gegangenen „Dreißigjährigen Krieges“ immer noch nach. Auch in Wasserliesch
mit seinem heutigen Ortsteil Reinig, damals noch eigenständige Gemeinde, hatte
es während dieses Krieges viele Überfälle und Brandschatzungen fremder Truppen
gegeben. Die überwiegende Zahl der Bewohner soll dabei ums Leben gekommen sein.
Es herrschte große Not und die Überlebenden kamen auch in den Folgejahren nicht
zur Ruhe. Immer wieder durchzogen fremde Söldner das Land, raubten und
brandschatzten und pressten die Bewohner aus.
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wirkten in
unserer Heimat die Folgen des mit dem „Westfälischen Frieden“ im Jahre 1648 zu
Ende gegangenen „Dreißigjährigen Krieges“ immer noch nach. Auch in Wasserliesch
mit seinem heutigen Ortsteil Reinig, damals noch eigenständige Gemeinde, hatte
es während dieses Krieges viele Überfälle und Brandschatzungen fremder Truppen
gegeben. Die überwiegende Zahl der Bewohner soll dabei ums Leben gekommen sein.
Es herrschte große Not und die Überlebenden kamen auch in den Folgejahren nicht
zur Ruhe. Immer wieder durchzogen fremde Söldner das Land, raubten und
brandschatzten und pressten die Bewohner aus.
Der Westfälische Friede hatte eine völlige
Neuordnung der politischen Verhältnisse in Deutschland gebracht. Nach dem Tode
Kaiser Ferdinand III. im Jahre 1657 erhielt Leopold I. die
Kaiserwürde. Doch der Deutsche Kaiser hatte seine Macht im Reich verloren, ihm
stand unter den Reichsfürsten nur noch der Vorsitz im Reichstag zu. Alle
größeren und kleineren Herrscher konnten im Prinzip nach Belieben schalten und
walten, waren aber auf Bündnisse mit den anderen Herrschern angewiesen, wenn
sie über ihre Grenzen hinweg etwas bewegen oder gar einen Krieg führen wollten.
Insgesamt soll es etwa 250 souveräne Staatsgebilde mit ihren Fürsten, Bischöfen,
Herzögen, Grafen und anderen Regenten gegeben haben. Das durch die
Zersplitterung in Kleinstaaten recht schwach gewordene Deutschland bildete den
Hintergrund für die Ereignisse, die zur Schlacht an der Konzer Brücke führten.
Der französische König Ludwig XIV.
konnte in dieser für ihn günstigen Lage die Vormachtstellung Frankreichs problemlos
weiter ausbauen. Hatte er keinen aktuellen Anlass, einen Krieg zu führen, fand
er einen, meist, um Frankreich Gebiete einzugliedern. Einer dieser Kriege war
der „Französisch-Niederländische Krieg“, auch „Holländischer Krieg“ genannt,
von 1672 bis 1678, in dessen Verlauf er die südlichen Provinzen der spanischen
Niederlande Frankreich einverleiben wollte. Auch wenn man auf den ersten Blick
keinen Zusammenhang zwischen diesem Krieg und der Schlacht an der Konzer Brücke
vermutet, hat sie sich doch aus diesem Konflikt ergeben.
 Zur Vorbereitung des Holländischen Krieges
ließ Ludwig XIV. schon Ende 1671 mit Zustimmung des Trierer Kurfürsten
Karl Kaspar von der Leyen – er hätte sie dem mächtigen Nachbarn wohl kaum
verweigern können – Truppen und Nachschubtransporte durch das Trierer Land
durchführen. Ab Mai 1672 gab es regelmäßige Truppen- und Provianttransporte auf
der Mosel. Allein in der Zeit von April bis August desselben Jahres zählte man
200 Versorgungsschiffe.
Zur Vorbereitung des Holländischen Krieges
ließ Ludwig XIV. schon Ende 1671 mit Zustimmung des Trierer Kurfürsten
Karl Kaspar von der Leyen – er hätte sie dem mächtigen Nachbarn wohl kaum
verweigern können – Truppen und Nachschubtransporte durch das Trierer Land
durchführen. Ab Mai 1672 gab es regelmäßige Truppen- und Provianttransporte auf
der Mosel. Allein in der Zeit von April bis August desselben Jahres zählte man
200 Versorgungsschiffe.
Der Trierer Erzbischof und Kurfürst zählte durchaus zu den bedeutenderen Fürsten. Er stand dem im 3. Jahrhundert gegründeten Bistum Trier vor, das im 6. Jahrhundert Erzbistum wurde. Seit 9o2 übten die Trierer Erzbischöfe neben der kirchlichen auch die weltliche Herrschaft aus. Ihr Herrschaftsbereich, auch „Kurtrier“ genannt, wuchs ständig und umfasste in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nicht nur das Gebiet um die Stadt Trier herum, sondern auch das Land an der unteren Saar, weite Regionen von Eifel und Hunsrück und Teile von Westerwald und Taunus. Trier war auch 1672 noch die Hauptstadt des Kurfürstentums, doch der Kurfürst residierte, nachdem es ihm in Trier zu unsicher geworden war, ebenso wie seine Vorgänger seit 1629, im Schloss Philippsburg in Ehrenbreitstein – heute Stadtteil von Koblenz.
Im März 1673 überfiel Ludwig XIV. das bis dahin neutrale Holland. Der „Große Kurfürst“ Friedrich Wilhelm von Brandenburg schloss sich daraufhin mit dem deutschen Kaiser zusammen in der Absicht, Holland mit einer gemeinsamen Armee von der Eifel her zu Hilfe zu kommen. Dazu kam es jedoch zunächst nicht, denn der Trierer Kurfürst stimmte dem Übergang der Armee über den Rhein bei Koblenz nicht zu. Er wollte aus Sorge um sein Land nicht offen Partei ergreifen und neutral bleiben.
Die kaiserlichen Truppen zogen anschließend von Koblenz aus, trotz des Einspruchs des Kurfürsten, in südlicher Richtung weiter. Ludwig XIV. nahm daraufhin an, der Kurfürst habe den Kaiserlichen den Rheinübergang an anderer Stelle gestattet. In der Tat hatte es eine geheime Abmachung gegeben. Der Kurfürst war aber überzeugt, seine Neutralität nicht verletzt zu haben, zumal er die Truppentransporte der Franzosen durch sein Gebiet weiterhin erlaubte. Ludwig XIV. verstand diese Vorgänge jedoch als Affront, erst recht, nachdem der Kurfürst auch noch einige kaiserliche Kompanien zum Schutz seines Landes in Trier stationieren ließ; außerdem befürchtete Ludwig, die für ihn wichtigen Wasserstraßen Mosel und Rhein zu verlieren.
Der Rachefeldzug Ludwig XIV.
Nachdem sich die Holländer gegen den Überfall der Franzosen mit einem Trick erfolgreich zur Wehr gesetzt hatten – sie öffneten die Schleusen und setzten weite Teile ihres Landes unter Wasser, nahm Ludwig XIV. seinen Misserfolg als Gelegenheit, einen Rachefeldzug gegen Trier zu beginnen. Aber es ging ihm sicher nicht nur um Rache, sondern eben auch um die wichtigen Transportwege Mosel und Rhein. So zog er im Juli 1673 eine 20 000 Mann starke Armee aus Holland ab und besetzte, von Luxemburg her kommend, große Teile des Trierer Landes. Den Heerführern der Besatzungstruppen hatte er aufgetragen, von der Bevölkerung 133 000 „Livres“ als Kontribution für den Unterhalt seiner Truppen einzutreiben. („Livre“ ist die Bezeichnung für ein französisches Pfund, das Livre war kein Zahlungsmittel, sondern eine Rechnungseinheit; die geforderte Summe könnte in etwa 15 Millionen Euro entsprechen).
Die Bewohner waren natürlich nicht in der Lage, soviel Geld aufzubringen. Was das zur Folge hatte, kann sich jeder ausmalen, der weiß, was fremde Soldaten unter solchen Umständen mit der Zivilbevölkerung tun. Einzelheiten dazu nennt ein Bericht des Trierer Amtes St. Maximin, der heute im Stadtarchiv aufbewahrt wird. Hierin heißt es in der damaligen Ausdrucks- und Schreibweise:
„Alle Dorfschaften...sind überfüllt mit dem Kriegsvolck, Musquetiers und der Leibguarde des Königs. Es ist nicht ein einziger Cavallier von ihnen, der nicht ein oder zween Diener habe. Es sind Häuser, worin 6 oder 8 zugleich und so viel Knecht und Pferdt inlogiert sein. Sie verderben und verhergen den ganzen Erndt. Es ist ein Elend und Jammer zu sehen und zu hören der armen vorhin verderbten Unterthanen Geschrei und Lamentationes.“
Von den Behörden und Klöstern der Region holten sich die Franzosen das nötige Bargeld. Dazu heißt es in dem Bericht:
„Monsieur de Fourille (ein französischer General) tringt stracks das Geld zu haben. Das Amt Wittlich hat 3 000 Reichsthaler accordieren müssen, womit sie das Amt verlassen und delogieren möchten, und sollen besagte Truppen das Amt Welchbillig beziehen und darin Quartier machen. Er, der Fourille, hauset gleichermaßen mit der Cleresey (Geistlichkeit). Den Abt zu Hemmerode hat er auf 2 000 Reichsthaler gezwungen, ebenmäßig Clausen soviel, Sprangersbach 1 000, das Hospital Cues 500 Reichsthaler und also fort mit den anderen.“
Nach der Besetzung großer Teile seines Landes durch die Franzosen wandte sich der Trierer Kurfürst immer wieder mit der Bitte um Hilfe an den Reichstag, doch zunächst ohne Erfolg.
Am 24. August 1673 hatten die Franzosen Trier vollständig eingeschlossen, die Stadt selbst aber noch nicht eingenommen. Die Aufforderung, sich zu ergeben, lehnte der Verhandlungsführer des Kurfürsten, einer der Domherren, ab. Das reizte Ludwig XIV. noch mehr, woraufhin er die Stadt mit Kanonen beschießen ließ. In einem Brief an seinen Kriegsminister schrieb er dazu: „Je veux faire tout ce que sera necessaire pour prendre Trèves (Ich werde alles tun, was nötig ist, um Trier einzunehmen).“ Als die Stadtmauern dem Beschuss nicht mehr standhielten, musste sich die Stadt am 7. September 1673 nach 14tägiger Belagerung ergeben. 6 000 Franzosen besetzten die Stadt, die Verwaltung übernahm ein französischer Gouverneur. Die kurtrierischen und kaiserlichen Truppen, die sie verteidigt hatten, setzten sich per Schiff in Richtung Koblenz ab. In der Folgezeit bauten die Franzosen die Stadt zu einer Festung aus. Um für die Abwehr eines Vergeltungsangriffs der kaiserlichen Truppen freies Schussfeld zu haben, ließen sie fast alle Gebäude außerhalb der Stadtmauern niederreißen. Dieses Vorhaben war Ende 1674 abgeschlossen, die Stadt glich danach in der Tat einer Festung, aber ihre Umgebung war verwüstet.
Die Schlacht an der Konzer Brücke
Die Hilferufe des Kurfürsten an den Reichstag begannen Früchte zu tragen. Der Kaiser schloss mit Spanien und den Niederlanden eine Koalition gegen Frankreich. Es gelang ihm so, bis Ende 1673 ein Heer aufzustellen und die Franzosen aus dem rechtsrheinischen Gebiet, wo sie bis an Tauber und Main vorgedrungen waren, zu vertreiben. Im Frühjahr 1674 erhielt das Heer Verstärkung durch Truppen aus Mainz, Trier und der Kurpfalz. Im Juli trat auch der Große Kurfürst von Brandenburg der Koalition bei. Am 24. Mai erklärte der Reichstag zu Regensburg Frankreich den Krieg.
Drei Armeen hatte der Kaiser für den Einsatz gegen Frankreich aufgestellt, eine davon zog er in Köln zusammen. Sie bestand aus 2 500 Mann lothringisches Militär des Herzogs Karl V. von Lothringen, dem Ludwig XIV. zuvor sein Land genommen hatte, 8 000 Mann mit 14 Geschützen des Herzogs Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg, 3 000 Osnabrückischen Soldaten, 800 Reitern des Herzogs Ernst August von Braunschweig-Lüneburg, 3 000 Soldaten des Bischofs von Münster, 3 500 Mann der kaiserlichen Truppen – darunter 2 000 aus Luxemburg und nochmals 2 000 spanischen Soldaten aus Luxemburg sowie 3 000 Kurtrierische Fußsoldaten und Reiter. Ein stattliches Heer also, das am 14. Juli 1675 aufbrach, um die Stadt Trier und das Trierer Land den Franzosen wieder abzunehmen.
Am 4. August begannen
die Kaiserlichen, die Stadt Trier einzuschließen. Ludwig XIV. ließ deshalb ein Entsatzheer, bestehend aus 15 000
Mann mit 11 Kanonen, unter Führung des Marschalls François de Bône de
Créqui (auch: „de Créquy“ geschrieben) von Lothringen her
in Marsch setzen, um den in der Stadt eingeschlossenen Franzosen zu Hilfe zu
kommen. Auf der alten römischen Heerstraße über den heutigen Saargau kommend
lagerte das Heer am 9. August zunächst auf einer Anhöhe bei Tawern, etwa zwei
Kilometer südlich des Schlachtfeldes. Von dort aus rückte es am Tag der
Schlacht in die Talweitung zwischen der Konzer Brücke und dem Liescher Berg
vor und besetzte auch die umliegenden niedrigeren Erhebungen einschließlich der
Granahöhe.
Die kaiserlichen Heerführer ließen einen
Teil der Belagerer vor der Stadt Trier zurück. Sie stießen mit dem größten Teil
der Streitkräfte über den Berg, dem heutigen Stadtteil von Konz, Roscheiderhof,
hinweg, zur Konzer Brücke vor, um die Saar zu überqueren und den Franzosen in
der Talweitung entgegenzutreten. Zeitgleich setzte ein weiterer französischer
Truppenverband mit 2 800 Mann und 6 Kanonen unter General Granvalle von
der gegenüberliegenden Flussseite her über die Mosel in der Absicht, die
deutschen Truppen am Überqueren der Saar zu hindern. Doch es gelang den
Kaiserlichen, die von den Franzosen besetzte und teilweise zerstörte Konzer
Brücke zu befreien. Pioniere machten sie behelfsmäßig wieder benutzbar und
errichteten wenige Meter flussaufwärts eine von Booten getragene Behelfsbrücke.
Schon tags zuvor hatte General de Grana mit dem von ihm befehligten Teil des
kaiserlichen Heeres die Saar überquert, war entlang der Mosel nach Reinig –
heute Ortsteil von Wasserliesch – vorgestoßen. Dort gelang es ihm, zwei auf der
Mosel liegende Proviantschiffe der Franzosen zu erbeuten. Anschließend befreite
er die besetzte Granahöhe und richtete hier sein Hauptquartier ein.
Das war die Lage, aus der heraus sich am 11.
August 1675 die Schlacht an der Konzer Brücke entwickelte. General de Grana
leitete den Einsatz der ihm unterstellten kaiserlichen Truppen von der damals
unbewaldeten niedrigen Felsterrasse aus, die heute seinen Namen trägt. Sie bot
ihm einen umfassenden Überblick über das gesamte Schlachtfeld. Das kaiserliche
Heer überquerte unter Leitung der anderen Befehlshaber die Saar über die Konzer
Brücke und über die Pionierbrücke sowie durch einige Furten und griff die
Franzosen in der Ebene an.
Wegen der Übermacht der Franzosen und ihrer
geländebedingten Vorteile – sie konnten die bewaldeten Anhöhen um das
Schlachtfeld herum als Aufmarsch- und Rückzugsgebiet nutzen – war ein deutscher
Sieg eher unwahrscheinlich. Aber der sieggewohnte französische Marschall de
Créqui hatte die Stärke der der kaiserlichen Truppen unterschätzt und außerdem
nicht für eine ausreichende Sicherung des linken Flügels seiner Truppen
gesorgt. Als man ihm den Übergang der Kaiserlichen über die Saar meldete, soll
er gesagt haben: „Es sind immer noch nicht genug Deutsche herüber; lasst sie
nur kommen, je mehr, desto besser, umso mehr finden hier ihr Grab“. General
de Grana erkannte die Schwachstelle und setzte
von der Granahöhe aus, trotz des an dieser Stelle besonders schwierigen
Geländes, den „rechten Flügel“ dort an. Obwohl seine Truppen erst einmal eine
unwegsame Schlucht überqueren mussten, brachte diese Taktik die Wende im
Kampfgeschehen und entschied zuletzt „die Niederlage der Feinde nach
dreistündigem Kampf“, so die Inschrift auf dem Grana-Denkmal.
Die Lage, die sich daraus entwickelte,
beschreibt ein zeitgenössischer Bericht so: „In diesem Stande fielen die
Keyserlichen Truppen die Völcker (die Franzosen) so heftig an, dass sie
diese Regimenter gäntzlich schlugen und in die Pfanne hacketen, dabei dem
gantzen frantzösichen Lager ein solches Schrecken einjageten, daß ein jeder
mehr umb die Flucht als umb das Fechten dachte“. Die Kaiserlichen
verfolgten die Franzosen, etwa 50 Kilometer weit bis nach Sierck in Lothringen
unweit hinter der heutigen deutsch-französischen Grenze.
Das französische Heer wurde vollständig
aufgerieben. Die Franzosen erlitten katastrophale Verluste. 2 000 Mann
fielen, 1 600 gerieten in Gefangenschaft. Neben 80 Fahnen und Standarten
erbeuteten die kaiserlichen Truppen alle 11 Kanonen und 200 Wagen mit Versorgungsgütern.
Sogar das Tafelsilber Marschall de Créqui’s erbeuteten die Kaiserlichen. Aber
auch mehr als 1 000 kaiserliche Soldaten haben ihr Leben lassen müssen.
Viele der Gefallenen beider Seiten sollen in Massengräbern oberhalb der
Granahöhe auf einer etwas höher gelegenen Terrasse des Liescher Berges
im Distrikt „Auf der Kerrichhof“, in moselfränkischer Mundart: "Ob ’m
Körfich" (Auf dem Kirchhof), begraben worden sein – der Kultur- und
Orchideenweg überquert dieses Gelände.
Die Schlacht hat natürlich auch Spuren
hinterlassen: In der Talniederung fanden Bauern beim Bestellen ihres Landes bis
in die jüngere Vergangenheit hinein immer wieder mal Reste von Waffen und
anderem Kriegsgerät, Kanonenkugeln und viele Hufeisen.
So sah es in Wasserliesch und Reinig nach
der Schlacht aus
Nachdem die Franzosen sich Mosel aufwärts in Richtung
Lothringen abgesetzt hatten, verzichteten die Deutschen auf ihre Verfolgung,
zogen sich nach Trier zurück und setzten die Belagerung der Stadt fort.
Marschall de Créqui war mit einigen seiner Offiziere nach Saarburg entkommen.
Von dort aus schaffte er es, mit einer lothringischen Reiteruniform verkleidet,
in die belagerte Stadt zu gelangen und das Kommando über die eingeschlossenen
französischen Truppen zu übernehmen. Im weiteren Verlauf der Belagerung
weigerte de Créqui sich hartnäckig, zu kapitulieren und die Stadt zu übergeben.
Ein ungewöhnliches Ereignis kam den Deutschen zu Hilfe: die Unnachgiebigkeit de
Créquis führte zur Meuterei seiner eigenen Truppen. Sie öffneten den Kaiserlichen
am 6. September 1675 die Stadttore. Diese nahmen die Stadt in ihren Besitz und „der
durch deutsche Gesinnung ausgezeichnete Kurfürst Erzbischof Karl Caspar von der
Leyen zog wieder in seine Hauptstadt ein,“ so ist auf dem Granadenkmal zu
lesen.
De Créqui ergab sich nach der Einnahme der Stadt noch
immer nicht. Er besetzte den Dom und kämpfte mit wenigen seiner Getreuen
verbissen einen Ehrenkampf. Über die Umstände seiner Gefangennahme gibt es zwei
Versionen. Die eine besagt, dass er zuletzt in einen Turm des Trierer Doms geflüchtet
und dort von einem Braunschweigischen Offizier gefangen genommen worden sei.
Nach der anderen habe man ihn hoch zu Ross im Dom selbst hinter einem der
Altäre gestellt und festgenommen. Jedenfalls wurde er inhaftiert und nach
Koblenz in die Festung Ehrenbreitstein gebracht. Wenig später ließ ihn der Trierer
Kurfürst – vermutlich als Geste des guten Willens gegenüber Ludwig XIV. –
wieder frei.
Marschall François de Bonne de Créqui erschien neun Jahre später nach Einnahme der Stadt Luxemburg im Juni 1684 mit seinem Heer erneut in unserer Gegend und eroberte Trier ein weiteres Mal. Er ließ alle Türme der Stadt niederreißen und den Stadtgraben zuwerfen. So rächte er sich und wetzte die in der Schlacht an der Konzer Brücke erlittene Niederlage wieder aus.
Man kann die Frage stellen, ob die Schlacht an der
Konzer Brücke nicht auch auf die rivalisierenden Machtinteressen des Trierer
Kurfürsten Karl Caspar von der Leyen und Ludwig XIV. zurückzuführen war.
Sicher spielte das mit eine Rolle, doch die machtpolitischen Verhältnisse
damals lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass Ludwig XIV. – auch noch
nach der verlorenen Schlacht an der Konzer Brücke – auf Grund seiner Machtfülle
am „längeren Hebel“ saß. Der „glänzende Sieg“ der deutschen Truppen konnte also
nichts daran ändern, dass er den Konflikt am Ende für sich entschied. Auf der
Verliererseite standen aber nicht nur der Trierer Kurfürst, sondern auch die
Bewohner unserer Heimat, die über viele Jahre hinweg unter all diesen Ereignissen
leiden mussten.
Die Situation der hiesigen
Bevölkerung zwei Jahre nach der Schlacht verdeutlicht ein Gesuch um Steuererleichterung
aus dem Jahre 1677, das die „Landrichterei“ Grevenmacher (der Ort liegt in
Luxemburg, 10 km Mosel aufwärts) an die Abgeordneten der drei Staaten Flandern,
Herzogtum Luxemburg und Hennegau richtete. Darin heißt es, dass man, nachdem
einige Dörfer, darunter Wasserliesch und Reinig, von einem anderen Lehnsherrn
erworben worden seien, nun nicht mehr die Staatslasten tragen könne. Als
Begründung wird angeführt, die Dörfer seien „durch den ersten und zweiten
Durchzug und Aufenthalt Sr. Hoheit von Lothringen ruiniert und gebrandschatzt
worden, denn in jedem von ihnen haben die Truppen Sr. Hoheit die Häuser
eingerissen, alles Getreide, Lebensmittel und Vieh weggenommen und sie haben
ihnen nicht mehr so viel gelassen, dass sie säen können“. Bemerkenswert
ist, dass es in diesem Schreiben nicht einmal um die Folgen des Durchzugs
fremder Truppen geht, sondern um das Verhalten der Söldner Herzog Karl V. von
Lothringen, der mit seiner Armee in der Schlacht an der Konzer Brücke
maßgeblich zum Sieg über die Franzosen beigetragen hatte.
Wer sich einen bildlichen Eindruck der Schlacht an
der Konzer Brücke verschaffen will, dem sei das am Wasserliescher Marktplatz in
einem Schauraum ausgestellte Diorama empfohlen. Es zeigt eine ca. 3 m x 4 m
große Ansicht der Schlacht aus der Vogelschau. Als detailgetreues Modell,
angefertigt nach einer zeitgenössischen Darstellung der Schlachtordnung, vermittelt
es dem Betrachter recht eindrucksvoll eine Vorstellung vom Kampfgeschehen. Das
Modell erstellte im Jahre 1975 in mühevoller Kleinarbeit Adolf Metzdorf aus
Oberbillig, ein gebürtiger Wasserliescher Bürger, aus Anlass der
Feierlichkeiten zur Erinnerung an die damals tausend Jahre zurückliegende erste
urkundliche Erwähnung von Wasserliesch und Reinig aus dem Jahre 975. Damals
jährte sich die Schlacht an der Konzer Brücke zum dreihundertsten Mal.
Die Kriegergedenkstätte im Wald
 Auf dem Kultur- und Orchideenweg Wasserliesch
vom Ausgangspunkt am Tennisplatz herkommend, treffen Sie auf halber Berghöhe
im Wald, dem wegen seiner rundlichen Form so genannten „Kopf“, auf
eine Kriegergedenkstätte aus
dem Ersten Weltkrieg. Das Ehrenmal steht unmittelbar neben einer Felswand, dem historischen
„Karthäuser Steinbruch“, geschützt von einer niedrigen Stützmauer mit einem
einfachen steinernen Kreuz darauf. Im Gegensatz zu den meisten Gedenkstätten
dieser Art ist das Ehrenmal recht bescheiden mit Natursteinen gemauert, die
einen behauenen Sandsteinblock einfassen. Darauf steht ein Tatzenkreuz, wie
man es häufig auf oder an Kriegerehrenmalen und -gedenkstätten findet,
ursprünglich mit einem „W“ in der Mitte – steht vermutlich für „Weltkrieg“ –
und der Jahreszahl „1914“ darunter (beides im Bild eingefügt). Außerdem befand
sich über dem „W“ eine Kaiserkrone. Die Aufschriften auf dem Kreuz,
die man in alten Fotos sehen kann, sind heute leider nicht mehr zu erkennen. In
den Gedenkstein ist der Spruch eingemeißelt:
Auf dem Kultur- und Orchideenweg Wasserliesch
vom Ausgangspunkt am Tennisplatz herkommend, treffen Sie auf halber Berghöhe
im Wald, dem wegen seiner rundlichen Form so genannten „Kopf“, auf
eine Kriegergedenkstätte aus
dem Ersten Weltkrieg. Das Ehrenmal steht unmittelbar neben einer Felswand, dem historischen
„Karthäuser Steinbruch“, geschützt von einer niedrigen Stützmauer mit einem
einfachen steinernen Kreuz darauf. Im Gegensatz zu den meisten Gedenkstätten
dieser Art ist das Ehrenmal recht bescheiden mit Natursteinen gemauert, die
einen behauenen Sandsteinblock einfassen. Darauf steht ein Tatzenkreuz, wie
man es häufig auf oder an Kriegerehrenmalen und -gedenkstätten findet,
ursprünglich mit einem „W“ in der Mitte – steht vermutlich für „Weltkrieg“ –
und der Jahreszahl „1914“ darunter (beides im Bild eingefügt). Außerdem befand
sich über dem „W“ eine Kaiserkrone. Die Aufschriften auf dem Kreuz,
die man in alten Fotos sehen kann, sind heute leider nicht mehr zu erkennen. In
den Gedenkstein ist der Spruch eingemeißelt:
„Den gefallenen Kameraden von Wasserliesch, Reinig und Igel gewidmet“.
Reinig,
heute Ortsteil von Wasserliesch, nennt die Inschrift zusammen mit Wasserliesch
und Igel, weil es damals noch selbstständige Gemeinde war.
In
die Rückseite des Ehrenmals ist ein halbrunder Stein eingesetzt, der von einem
älteren Ehrenmal stammen könnte. Sein oberer Teil trägt ebenfalls ein
Tatzenkreuz. Darunter steht die Schrift „P.B.21.“ für „Pionierbatallion 21“ und
die Jahreszahl „1915“, daneben ein Herz, in dem das Christusmonogramm „JHS“
fast vollständig verwittert ist. (Die Abkürzung „JHS“ hat mehreren Bedeutungen,
in Deutschland wird sie meist mit „Jesus, Heiland, Seligmacher“ gedeutet). Der
halbrunde Stein war offensichtlich in zwei Teile zerbrochen, bevor man ihn in
das Ehrenmal einsetzte.
Die
„Chronik Wasserliesch“ weiß, dass das Ehrenmal in der ersten Jahreshälfte des
Jahres 1915 errichtet und am 9. Mai desselben Jahres feierlich eingesegnet
worden ist. Es fällt auf, dass der Krieg zu diesem Zeitpunkt erst begonnen
hatte, in den restlichen Kriegsjahren sind ja noch viele weitere Soldaten
gefallen. Üblicherweise errichtet man den Gefallenen ein Ehrenmal doch erst
nach Kriegsende.
Und
aus welchem Grund hatte man ausgerechnet diesen Standort gewählt?

 Etwas ungewöhnlich ist es ja schon, ein Kriegerehrenmal in freier Natur
recht einsam im Wald aufzurichten. Man erwartet es eher auf dem Friedhof, einem
Platz im Ort oder wenigstens dort, wo die Menschen, an deren Angehörige es
erinnert, wohnen. Der Grund ist nicht bekannt. Möglicherweise hatte man sich
nicht auf einen anderen Standort verständigen können. Es kann aber auch sein,
dass es hier schon vorher eine Gedenkstätte aus früheren Kriegen, beispielsweise
aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, mit dem in die Rückseite
eingesetzten Gedenkstein gegeben hat.
Etwas ungewöhnlich ist es ja schon, ein Kriegerehrenmal in freier Natur
recht einsam im Wald aufzurichten. Man erwartet es eher auf dem Friedhof, einem
Platz im Ort oder wenigstens dort, wo die Menschen, an deren Angehörige es
erinnert, wohnen. Der Grund ist nicht bekannt. Möglicherweise hatte man sich
nicht auf einen anderen Standort verständigen können. Es kann aber auch sein,
dass es hier schon vorher eine Gedenkstätte aus früheren Kriegen, beispielsweise
aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, mit dem in die Rückseite
eingesetzten Gedenkstein gegeben hat.
Auch die Frage, weshalb man das Ehrenmal drei Jahre vor dem Ende des Ersten Weltkrieges, der ja erst 1918 zu Ende ging, hier aufstellte, kann nicht mehr so ohne weiteres beantwortet werden. Eine Erklärung liefert vielleicht die an der Westfront nach den ersten Kriegsmonaten entstandene Situation.
Als am 31. Juli 1914 der Kriegszustand erklärt und einen Tag später der Deutsche Kaiser und die französische Regierung die allgemeine Mobilmachung anordneten, überschlugen sich hier die Ereignisse. Man rechnete so nahe der französischen Grenze – nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen vergangener Zeiten – mit einem Überfall der Franzosen von Westen her. Es begannen umfangreiche deutsche Truppenbewegungen ins benachbarte Luxemburg und nach Lothringen. Bereits am 2. August 1914 besetzten deutsche Soldaten die Stadt Luxemburg. Gleich danach erklärte Deutschland Frankreich offiziell den Krieg, unter anderem wegen mehrerer seitens der Franzosen begangener Grenzverletzungen in Lothringen. Am 4. August drangen deutsche Truppen völkerrechtswidrig in das bis dahin neutrale Belgien ein in der Absicht, das Land zu durchqueren, die Franzosen unter Umgehung ihrer gegen die deutschen Grenzen gerichteten Verteidigungslinien von Norden her anzugreifen und in einer großen Zangenbewegung möglichst schnell zu bezwingen. Dieses wiederum nahm dann auch England zum Anlass, Deutschland am 5. August 1914 den Krieg zu erklären.
Erste für beide Seiten verlustreiche Kämpfe gab es schon unmittelbar nach Kriegsausbruch. Ende August 1914 entwickelten sich zwischen den Vogesen und der Schelde die so genannten Grenzschlachten, die zusammen mit der Marneschlacht im September hohe Verluste an Menschen und Material zur Folge hatten. Etwa Mitte November, nach den Kämpfen bei Ypern, nahmen die kriegerischen Aktivitäten an der Westfront etwas ab, das Kräfteverhältnis zwischen den Krieg führenden Armeen war zu diesem Zeitpunkt weitgehend ausgeglichen, weshalb sich danach der noch lange andauernde Stellungskrieg entwickelte. Die Front war gewissermaßen „erstarrt“.
Diese Situation vermittelte vermutlich in Wasserliesch und Umgebung, vielleicht sogar allgemein, den Eindruck, der Krieg sei schon gewonnen und gehe schnell zu Ende. In Deutschland herrschte ja, wie das zumindest in der Anfangsphase der Kriege immer wieder der Fall gewesen ist, die allgemeine Zuversicht, man könne ihn rasch für sich entscheiden. Anfängliche Siege der deutschen Truppen stützten diese, wie wir heute wissen, allzu positive Einschätzung. Vor diesem Hintergrund mag der Wunsch aufgekommen sein, schon vor Kriegsende ein Kriegerehrenmal für die Gefallenen zu errichten. Die Initiative dazu soll aber nicht von den Einwohnern ausgegangen sein, sondern von einer der hier stationierten deutschen Pioniereinheiten, dem Pionierbatallion 21 aus Mainz-Kastel. Eine erste Einheit sei bereits am 7. August 1914 mit etwa 110 Soldaten in Igel, Wasserliesch und Reinig eingerückt und bei den Bewohnern einquartiert worden, wissen zeitgenössische Quellen zu berichten. Diese Einheit hatte den Auftrag, eine hölzerne Pionierbrücke zwischen Reinig und Igel über die Mosel hinweg zu errichten, sie zu bewachen und für die Truppenbewegungen und den Nachschub verfügbar zu halten. Der Bau der Brücke begann am 8. August und war wenige Tage später abgeschlossen. Sie verband nun die beiden Orte und stand hier bis zum 13. Dezember 1915, als Hochwasser der Mosel sie hinwegspülte. Danach baute man sie nicht wieder auf, weil das Geld fehlte.
Während der Stationierung der Pioniereinheiten entwickelten sich vielfältige Kontakte zwischen den Pionieren und den Familien, bei denen sie einquartiert waren. Auf Grund des engen und freundschaftlichen Verhältnisses zur Bevölkerung, das sich ergeben hatte, und als Dank für die freundliche Aufnahme, sollen die Pioniere beschlossen haben, den Gefallenen der drei Gemeinden ein Ehrenmal zu errichten. Die Initiative kann aber ebenso gut von den Bewohnern ausgegangen sein, wobei das Vorhandensein einer Brücke über die Mosel ein solches Vorhaben beflügelt haben könnte. Die immer schon bestehenden engen Bindungen der drei Nachbarorte zueinander dürften durch die Brücke zusätzlichen Auftrieb erhalten haben. Wie auch immer, bestimmt bediente man sich aber bei der Herrichtung des Geländes und der Aufstellung des Ehrenmals der Hilfskräfte und technischen Möglichkeiten, die eine Pioniereinheit bieten kann. Den Gedenkstein haben wohl eher einheimische Steinmetze bearbeitet, denn dieses Handwerk besitzt in Wasserliesch und Reinig bis heute eine lange Tradition. Fesst steht jedenfalls, dass sich das „Pionierbatallion 21“ aus Mainz auf der Rückseite des Ehrenmals „verewigt“ hat. Es darf daher als Erbauer des Ehrenmals gelten.
Bleibt noch nachzutragen, dass man am 9. Mai 1915 nach der Feier zur Einsegnung des Ehrenmals einen Maikranz band und ihn mit Musikbegleitung durch Reinig und Wasserliesch trug; möglicherweise handelte es sich dabei auch um eine Art Siegesfeier. Dass die Stimmung tatsächlich so gewesen ist, belegen die Aufzeichnungen eines Wasserliescher Lehrers. Nach ihnen wurde die Bevölkerung etwa nach einem Sieg der Deutschen über die Franzosen bei Lunéville Anfang September 1914 aufgerufen, die Häuser zu beflaggen und den Sieg zu feiern. Einer der Brückenposten soll aus diesem Anlass im alkoholisierten Zustand "die Straßen von Reinig und Wasserliesch unter Gewehrhagel versetzt" haben, man habe ihn nur mit Mühe daran hindern können, Schlimmeres anzurichten.
Nebenbei
bemerkt: Aus der Einweihungsfeier am 9. Mai 1915 entwickelte sich ein schöner
Brauch, der noch über den Zweiten Weltkrieg hinaus hier praktiziert wurde:
Jedes Jahr am ersten Mai spielten Bläser bei Tagesanbruch im „Kopf“ vor dem
Ehrenmal das „Lied vom guten Kameraden“, dessen Klänge dann der Wind aus
dem Wald heraus über Reinig hinwegtrug.
 Eine Art „Ergänzung“ bekam das Kriegerehrenmal im „Kopf“ im Jahre 1945
während der letzten Tage des Zweiten Weltkrieges mit einem Soldatengrab.
Eine Art „Ergänzung“ bekam das Kriegerehrenmal im „Kopf“ im Jahre 1945
während der letzten Tage des Zweiten Weltkrieges mit einem Soldatengrab.
Auf dem Liescher Berg war damals eine deutsche Flakeinheit zur Abwehr feindlicher Luftangriffe stationiert. Ihr gehörte auch der Obergefreite Franz Krömer aus dem oberschlesischen Oppeln, dem heute polnischen Opole, an. Als die amerikanische Infanterie von Südwesten her die Stellung dieser Einheit angriff, entwickelten sich auf dem Berg und an seinen Hängen heftige Kämpfe, in deren Verlauf Granatwerfer eingesetzt wurden. Etwa 100 m vom Kriegerehrenmal entfernt schlug am 21.2.1945 eine der Granaten ein, tötete Krömer und verwundete zwei weitere deutsche Soldaten schwer.
Die
Wasserliescher Bevölkerung war zu diesem Zeitpunkt bis auf einige Wenige
evakuiert. Zwei der im Dorf zurückgebliebenen Männer fanden den Gefallenen und
die beiden Verwundeten im Wald in der Nähe des Kriegerehrenmals. Nachdem sie
die Verletzten mit Hilfe anderer versorgt und ins Dorf geschafft hatten,
bestatteten sie den Toten unmittelbar neben dem Ehrenmal. „In Pferdedecken
eingehüllt senkte man ihn in die Erde und gab ihm den Schaft des Karabiners
und zwei Handgranaten mit“, so die „Chronik Wasserliesch“. Ein einfaches
Birkenkreuz schmückte die Grabstätte. Es wurde später durch ein anderes
Holzkreuz mit dem Namen des Toten ersetzt.
Die
Grabstätte wurde zunächst von einer ortsansässigen Familie betreut; nachdem die
Angehörigen gefunden waren, überließ man ihnen die Pflege. Sie stand noch bis
in die 1970er Jahre hinein. Heute erinnert noch einer der Gedenksteine des
kleinen Ehrenfriedhofs neben der Wasserliescher Friedhofskapelle an das
Soldatengrab.
 Als aufmerksamer Wanderer werden Sie gleich neben dem Kriegerehrenmal
eine nicht fertiggestellte über 300 Jahre alte Inschrift an der
Felswand des ehemaligen „Karthäuser Steinbruchs“ entdecken und zu entziffern
versuchen. Ihr Wortlaut bezieht sich in keiner Weise auf diesen ehrwürdigen
Ort. Vermutlich haben Steinbrecher sie Anfang des 18. Jahrhunderts hier eingemeißelt,
bevor der Abbau von rotem Sandstein eingestellt wurde. Über den Grund der
Schließung des Steinbruchs ist nichts bekannt. Möglicherweise genügten die
dort gebrochenen Steine nicht mehr den Qualitätsanforderungen, oder man
erschloss einen der anderen Steinbrüche, die rings um den Liescher Berg
herum zum Teil noch bis in das 20. Jahrhundert hinein in Betrieb gewesen sind.
Als aufmerksamer Wanderer werden Sie gleich neben dem Kriegerehrenmal
eine nicht fertiggestellte über 300 Jahre alte Inschrift an der
Felswand des ehemaligen „Karthäuser Steinbruchs“ entdecken und zu entziffern
versuchen. Ihr Wortlaut bezieht sich in keiner Weise auf diesen ehrwürdigen
Ort. Vermutlich haben Steinbrecher sie Anfang des 18. Jahrhunderts hier eingemeißelt,
bevor der Abbau von rotem Sandstein eingestellt wurde. Über den Grund der
Schließung des Steinbruchs ist nichts bekannt. Möglicherweise genügten die
dort gebrochenen Steine nicht mehr den Qualitätsanforderungen, oder man
erschloss einen der anderen Steinbrüche, die rings um den Liescher Berg
herum zum Teil noch bis in das 20. Jahrhundert hinein in Betrieb gewesen sind.
Ob die Inschrift im Zusammenhang mit der Schließung des Steinbruchs steht, lässt sich ihrem Wortlaut aber nicht entnehmen. Sie befasst sich aber mit dem, was die Steinbrecher im 17. und 18. Jahrhundert, ebenso wie viele Arbeiter heute noch, beschäftigt haben dürfte. In der damals üblichen Schreibweise stellen sie fest:
"A. D. 1702 VNT 3 HABEN WIR DEN WEIN FOVR 1 ALBVS"
Im Klartext: „In den Jahren 1702 und 3 haben wir den Wein für einen Albus ...“ Am Ende fehlt vermutlich das Wort „getrunken“ oder eine andere Fortsetzung des Textes, der, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr fertig geworden ist. Der "Albus", zu Deutsch "Weißpfennig“, war eine Münze, die der Trierer Erzbischof Kuno von Falkenstein nach 1368 in Umlauf setzte. Sie war damals westlich des Rheins sowie am Mittel- und Niederrhein gültiges Zahlungsmittel. Der mit „1 Albus“ angegebene Kaufpreis für den Wein beziehe sich auf ein „Quart“, vermutet die „Chronik Wasserliesch“. Das Quart, abgekürzt „Q“, bezeichnet eine alte deutsch-angloamerikanische Maßeinheit für Flüssigkeiten. Ein Quart entsprach einer Menge von 1,145 Liter.
Was aber sollte die Inschrift bezwecken? Haben sich die Steinbrecher hier auf originelle Art und Weise über den Preisanstieg beim Wein beklagt, einem Getränk, mit dem sie während oder nach der Arbeit ihren Durst löschten? Wenn das so war, ist der Spruch durchaus auch heute noch aktuell.
Die Römer
waren auf dem Liescher Berg
 Entlang des Kultur- und Orchideenweges Wasserliesch gibt es
auf dem Hochplateau des Liescher Berges weitere Zeugnisse vergangener
Zeiten. Nahe des Wanderweges, der neben der Löschemer Kapelle bergwärts
abzweigt, gibt es rätselhafte Überreste aus früheren Zeiten, deren
Herkunft nicht bekannt ist. Wenn Sie den Waldrand entlang etwa 200 m weit
gegangen sind, stoßen Sie rechts des Weges, gleich hinter der Stelle, an der
Sie in den Wald eintreten, darauf.
Entlang des Kultur- und Orchideenweges Wasserliesch gibt es
auf dem Hochplateau des Liescher Berges weitere Zeugnisse vergangener
Zeiten. Nahe des Wanderweges, der neben der Löschemer Kapelle bergwärts
abzweigt, gibt es rätselhafte Überreste aus früheren Zeiten, deren
Herkunft nicht bekannt ist. Wenn Sie den Waldrand entlang etwa 200 m weit
gegangen sind, stoßen Sie rechts des Weges, gleich hinter der Stelle, an der
Sie in den Wald eintreten, darauf. Hier,
an der höchsten Stelle des Liescher Berges, erstrecken sich entlang
eines geraden etwa 50 cm tiefen Grabens, der schon an der Kapelle beginnt
und den Sie, nachdem er nach rechts abgebogen ist, beim Eintritt in den Wald überqueren,
auf einer etwa 300 m langen und 30 m breiten Fläche, überwuchert
von Bäumen und Sträuchern, eine größere Zahl bemooster Steinhaufen,
Steinwälle und weitere Gräben. Auf den ersten Blick wirken sie wie natürliche
Gebilde. Doch bei genauerem Hinsehen werden Sie feststellen, dass sie von
Menschenhand geschaffen sein müssen. Die umherliegenden oder aufeinander
gesetzten Steine sind zum Teil als Mauersteine geformt oder von Steinmetzen
bearbeitet worden. Kreisförmige und eckige Bodensenken könnten Reste
von Bauwerken sein. Vielleicht waren es auch nur Unterkünfte, in denen
Menschen Schutz gesucht haben oder es sind militärische Stellungen gewesen.
Im Manuskript eines damaligen Wasserliescher Lehrers für eine Wasserliescher
Chronik heißt es zu diesem Gelände: „Das auf dem Kamm des Berges sich
ausdehnende Plateau hat uns auch geschichtlich etwas zu erzählen. Unter der
Lieschemer Kapelle hat man Mauerreste gefunden, die auf mittelalterlichen
Ursprung schließen lassen. Der Platz, ziemlich groß, schön gelegen und
ziemlich geebnet, ist jetzt zum Teil Ackerland und zum Teil mit Fichten
bestanden.“
Es
ist also sehr gut möglich, dass es hier oben schon lange vor dem Bau der Löschemer
Kapelle Gebäude und Anlagen größeren Umfanges gegeben hat.
 Mitten auf einem der Steinhaufen markiert ein Stein mit einem Zeichen
und der Nummer 285 darauf einen trigonometrischen Punkt. Er wurde im Jahre
1844 hier aufgestellt. Teil der Gesamtanlage ist er sicher nicht. Wie
diese einmal ausgesehen hat und welchem Zweck sie diente, ist nicht bekannt.
Vielleicht wurde das Gelände schon zur Römerzeit genutzt, denn schließlich
bot der Liescher Berg zu allen Zeiten auf Grund seiner exponierten
Lage mit einer Rundumsicht in nahezu alle Richtungen ideale Voraussetzungen
für eine Nutzung durch das Militär, etwa als Vorposten zum Schutz der Stadt
Trier.
Mitten auf einem der Steinhaufen markiert ein Stein mit einem Zeichen
und der Nummer 285 darauf einen trigonometrischen Punkt. Er wurde im Jahre
1844 hier aufgestellt. Teil der Gesamtanlage ist er sicher nicht. Wie
diese einmal ausgesehen hat und welchem Zweck sie diente, ist nicht bekannt.
Vielleicht wurde das Gelände schon zur Römerzeit genutzt, denn schließlich
bot der Liescher Berg zu allen Zeiten auf Grund seiner exponierten
Lage mit einer Rundumsicht in nahezu alle Richtungen ideale Voraussetzungen
für eine Nutzung durch das Militär, etwa als Vorposten zum Schutz der Stadt
Trier. Konkretere
Hinweise für eine Nutzung des Hochplateaus gibt es für das Alte Lager
an der südwestlichen Seite. Der am Parkplatz „Perfeist“ vorbeiführende
Kultur- und Orchideenweg Wasserliesch führt Sie in einer großen
Schleife wenige Meter an dem Kulturdenkmal vorbei. Weitgehend bewachsen
mit Bäumen und Sträuchern können Sie hier ausgedehnte Gräben und Ruinen
mit Mauerresten bestaunen, die zu einem antiken Militärlager gehören.
Seine Geschichte reicht weit zurück, aber niemand weiß genau, wie alt es
ist. Fachleute datieren es ins 3. Jahrhundert, doch ist das, ebenso wie
Vermutung, dass die Römer es erbauten und nutzten, nicht durch Urkunden
oder andere Quellen belegt.
Um
das Lager herum bricht die Bergkante nach drei Seiten hin abrupt ab. Mit einem
Steinwall nach diesen Seiten hin geschützt war das Lager schon allein auf Grund
dessen bestens gegen mögliche Angriffe abgesichert. Zweifellos ist es
eine dafür bestens geeignete Stelle, an der die Erbauer es errichteten,
denn die Anlage war nicht nur schwer einnehmbar, sondern bot auch weitreichende
Sicht hinunter ins Moseltal und auf die umliegenden Höhen von Ardennen,
Eifel und Saargau.
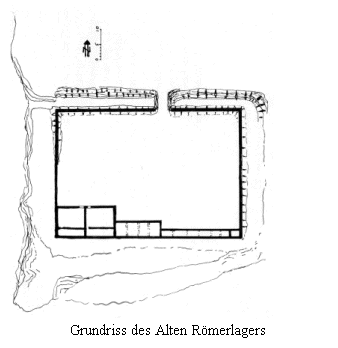 Es hat in der Vergangenheit mehrere Versuche gegeben, Nachweise zum Ursprung
und zur Zweckbestimmung des Lagers zu finden. So führte man hier schon im
Jahre 1853 Ausgrabungen durch, aber es kam nicht sehr viel dabei heraus. Außerdem
weiß die „Chronik Wasserliesch“ von Ausgrabungen zu berichten, die
auf Wunsch vieler Bewohner von Wasserliesch und Reinig mit einem
Arbeitsaufwand von 100 bis 200 Arbeitstagen Ende des 19. Jahrhunderts
durchgeführt worden seien; man habe sie am 17. März 1896 abgeschlossen. Im
Verlauf dieser Aktion legte man Umfassungsmauern verschiedener Gebäude
frei. Auch sollen am südlichen Rand, in dem abschüssigen Gelände unterhalb
der Anlage, Mauerwerk und Gewölbereste gefunden worden sein, die zu einem
unterirdischen Gang gehört haben könnten. Ferner grub man in den Jahren
1973/74 in dem Gelände, fand aber nur einige Dachziegel sowie zerbrochene
Töpfe und Krüge, die nach Meinung der Archäologen aus der Römerzeit stammen
könnten. Für die Wasserversorgung hatten die Erbauer eine Zisterne gegraben,
die vielleicht das Wasser des etwa 80 Höhenmeter tiefer gelegenen
„Angelborn“ nutzte, der noch bis nach Ende des Zweiten Weltkrieges auch
der Trinkwasserversorgung von Wasserliesch und Reinig diente.
Es hat in der Vergangenheit mehrere Versuche gegeben, Nachweise zum Ursprung
und zur Zweckbestimmung des Lagers zu finden. So führte man hier schon im
Jahre 1853 Ausgrabungen durch, aber es kam nicht sehr viel dabei heraus. Außerdem
weiß die „Chronik Wasserliesch“ von Ausgrabungen zu berichten, die
auf Wunsch vieler Bewohner von Wasserliesch und Reinig mit einem
Arbeitsaufwand von 100 bis 200 Arbeitstagen Ende des 19. Jahrhunderts
durchgeführt worden seien; man habe sie am 17. März 1896 abgeschlossen. Im
Verlauf dieser Aktion legte man Umfassungsmauern verschiedener Gebäude
frei. Auch sollen am südlichen Rand, in dem abschüssigen Gelände unterhalb
der Anlage, Mauerwerk und Gewölbereste gefunden worden sein, die zu einem
unterirdischen Gang gehört haben könnten. Ferner grub man in den Jahren
1973/74 in dem Gelände, fand aber nur einige Dachziegel sowie zerbrochene
Töpfe und Krüge, die nach Meinung der Archäologen aus der Römerzeit stammen
könnten. Für die Wasserversorgung hatten die Erbauer eine Zisterne gegraben,
die vielleicht das Wasser des etwa 80 Höhenmeter tiefer gelegenen
„Angelborn“ nutzte, der noch bis nach Ende des Zweiten Weltkrieges auch
der Trinkwasserversorgung von Wasserliesch und Reinig diente.Immerhin
war das Römerlager nach diesen Funden für die Fachleute so interessant
geworden, dass es im Jahre 1976 endlich auch vom „Rheinischen Landesmuseum
Trier“ vermessen und archäologisch aufgenommen wurde. Es bildet insgesamt
ein großes Rechteck von 94 m Länge und 47 m Breite, dessen Längsachse
sich von Ost nach West erstreckt. Seine lang gestreckte Nordseite, an der der
Orchideenweg vorbeiführt, wird von einem 80 cm tiefen Graben begrenzt,
den ein 7,00 m breiter Zugang unterbricht. Weil diese der Hochfläche
des Berges zugewandte Seite möglichen Angreifern den leichtesten Zugang
bot, hatte man sie mit einem vorgelagerten Mauerriegel, der heute fast vollständig
abgetragen ist, zusätzlich abgeschirmt.
In
der Südwestecke des Lagers sind die Grundmauern eines rechteckigen Gebäudes
zu sehen, das 19,4 m lang und 12,0 m breit war. Daran schießt sich nach Osten
hin ein 6,0 m breiter lang gestreckter Bauflügel mit einem parallel
verlaufenden Mauerzug an. Nach dem Jahresbericht der „Trierer Gesellschaft für
nützliche Forschungen“, der sich auf das Jahr 1853 bezieht und ein Jahr später
herausgegeben wurde, war das Gebäude in 6 Innenräume unterteilt; ihre
Mauern sind noch erkennbar. Beschreibung und Lageskizze verdeutlichen, dass
das Römerlager militärischen Zwecken gedient haben muss. Es war wohl ein
Vor- und Beobachtungsposten zum Schutz der Stadt Trier. Aus der Tatsache,
dass man bei den Ausgrabungen nur wenige Überreste fand, schließen die
Fachleute, dass es nicht lange genutzt worden ist.
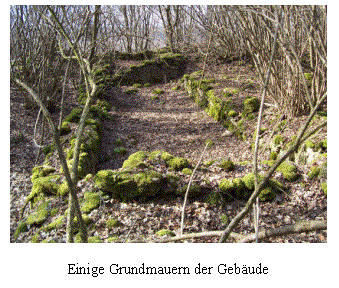 Im Jahre 1704 soll das Lager im Verlauf des Spanischen Erbfolgekrieges
(1701-1724) von dem englischen Feldherrn John Churchill, Herzog von Marlborough,
im Zuge der Befreiung der Stadt Trier von der französischen Besatzung, ausgebaut
oder genutzt worden sein. Diese Aktivitäten Marlboroughs fallen zeitlich mit
umfangreichen Sicherungs- und Schanzarbeiten im Bereich der Konzer Brücke
und ihrer Umgebung zusammen, für die er bis zu 6 000 Männer aus der
Landbevölkerung zur Ableistung des Frondienstes rekrutierte. Möglicherweise
gibt es damit einen Zusammenhang.
Im Jahre 1704 soll das Lager im Verlauf des Spanischen Erbfolgekrieges
(1701-1724) von dem englischen Feldherrn John Churchill, Herzog von Marlborough,
im Zuge der Befreiung der Stadt Trier von der französischen Besatzung, ausgebaut
oder genutzt worden sein. Diese Aktivitäten Marlboroughs fallen zeitlich mit
umfangreichen Sicherungs- und Schanzarbeiten im Bereich der Konzer Brücke
und ihrer Umgebung zusammen, für die er bis zu 6 000 Männer aus der
Landbevölkerung zur Ableistung des Frondienstes rekrutierte. Möglicherweise
gibt es damit einen Zusammenhang.Während
des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 soll die Anlage und die ganze
Hochfläche auf dem Liescher Berg noch einmal für das Militär interessant
gewesen sein. Damals habe Generalfeldmarschall Ludwig von Moltke sie in
Augenschein genommen, um sie als Vorposten für die Absicherung der Stadt
Trier auszubauen, was dann aber nicht geschah.
Wie
die „Chronik Wasserliesch“ berichtet, besichtigten in den Jahren 1912/13,
also vor Beginn des Ersten Weltkrieges, höhere deutsche Offiziere mehrmals das
Hochplateau des Liescher Berges. Sie erkannten wieder einmal die
strategische Bedeutung dieses Gebietes und ließen Abwehrstellungen bauen.
Schwere Artillerie sollte hier oben Stellung beziehen. Koblenzer Pioniere
und Trierer Infanteristen befestigten die Zufahrtsstraße vom Ort bis zur
Berghöhe. Aber es kam zu keiner militärischen Nutzung, denn eine vorab angelegte
Großübung, bei der ein Angriff der Franzosen von Westen her annahm, brachte
nicht das erhoffte Ergebnis. Auch während des Zweiten Weltkrieges nutzte das Militär
die Höhe. So grub sich eine Flakeinheit der Deutschen Wehrmacht im Jahre
1939 hier ein. Überreste der Stellungen sind im Orchideengebiet und
innerhalb des Römerlagers noch vorhanden. Andere Überreste militärischer
Stellungen aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges gibt es noch in der Nähe
der Löschemer Kapelle.
 Die Überlieferung verweist auf eine ganz andere Nutzung. Nach ihr soll
das Römerlager vor langer Zeit ein Kloster gewesen sein. Der Volksmund
nennt das Gebiet heute noch „Klostergarten“ – vielleicht ein Indiz für
diese Deutung. Es sei eine Niederlassung der „Tempelherren“, auch
„Templer“ genannt, gewesen. Gemeint ist der schon im Mittelalter europaweit
agierende Orden, den es in Deutschland unter dem Namen „Deutscher
Tempelherrenorden“ noch gibt.
Die Überlieferung verweist auf eine ganz andere Nutzung. Nach ihr soll
das Römerlager vor langer Zeit ein Kloster gewesen sein. Der Volksmund
nennt das Gebiet heute noch „Klostergarten“ – vielleicht ein Indiz für
diese Deutung. Es sei eine Niederlassung der „Tempelherren“, auch
„Templer“ genannt, gewesen. Gemeint ist der schon im Mittelalter europaweit
agierende Orden, den es in Deutschland unter dem Namen „Deutscher
Tempelherrenorden“ noch gibt. Meistens
werden solche Sagengeschichten im Lauf der Jahrhunderte immer wieder neu
gesponnen und erweitert. So wird auch gesagt, es habe von dem Lager aus einen
unterirdischen Gang hinunter ins Dorf gegeben, der in einem Wohnhaus
endete. Die auf dem Berg residierenden frommen Ordensleute hätten ihn,
nachdem sie sich zu Raubrittern gewandelt hatten, für ihre Raubzüge
genutzt. Für diese recht abenteuerliche Geschichte gibt es aber keinerlei
Belege, doch könnten die Baureste unterhalb des Römerlagers in der Nähe der
„Angelborn-Quelle“ die Entstehung der Sage des unterirdischen Ganges erklären.
Nüchtern
betrachtet ist es sehr unwahrscheinlich, dass es hier oben jemals ein Kloster
gegeben hat, denn gerade Klöster haben ihre Spuren überall in den Archiven und
wohl auch umfangreichere Baureste hinterlassen. Letztlich gibt es aber dafür
und für die anderen Erklärungen keine nachprüfbaren Quellen. So wird das
geschichtlich interessante Hochplateau auf dem Liescher Berg viele seiner
Geheimnisse wohl auch in Zukunft zu verbergen wissen.
Chronik Wasserliesch (Gemeinde Wasserliesch)
G. Kentenich, Geschichte der Stadt Trier
(Verlag der akademischen Buchhandlung Interbook, Trier)
Golo Mann, August Nitschke, Propyläen Weltgeschichte (Propyläen
Verlag Berlin-Frankfurt a. M.)
Brockhaus-Enzyklopädie
Wikipedia-Enzyklopädie
Jahresberichte der „Gesellschaft für nützliche
Forschungen“, Trier